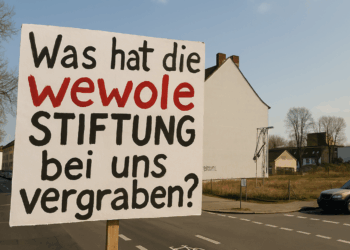Berlin/Köln/Pullach. [sn] Der jüngste Bericht des Westdeutschen Rundfunks (WDR) sorgt für heftige Debatten in Medienkreisen und unter Bürgerinnen und Bürgern: Der bekannte Journalist und Buchautor Peter Scholl-Latour wurde in den 1980er Jahren vom Bundesnachrichtendienst (BND) als sogenannte „Gelegenheitsquelle“ geführt. Die brisante Enthüllung berührt nicht nur Fragen zur journalistischen Unabhängigkeit, sondern wirft auch einen kritischen Blick auf den Umgang deutscher Behörden mit Pressefreiheit und Informationsquellen – Themen, die für das Selbstverständnis eines demokratischen Staates von größter Bedeutung sind.
Die Rolle von Peter Scholl-Latour: Zwischen Unabhängigkeit und nachrichtendienstlichem Interesse
Peter Scholl-Latour, der 2014 im Alter von 90 Jahren verstarb, galt vielen als Urgestein des kritischen Auslandsjournalismus. Bekannt für seine Reisen in Krisengebiete und seine aufklärerischen Berichte etwa aus Vietnam, dem Kongo oder dem Nahen Osten, genoss er das Vertrauen eines breiten Publikums. Umso überraschender nun die Enthüllung: Laut jüngst ausgewerteten BND-Akten, die dem WDR vorliegen, wurde Scholl-Latour seit einer Afghanistan-Reise 1981 als „Gelegenheitsquelle“ mit den Decknamen „Frank“, „Pedro“ und schließlich „Scholar“ geführt. Der Journalist soll dem Geheimdienst mehrfach über Reisen, Gesprächspartner und sogar Film- und Fotomaterial vor Veröffentlichung berichtet haben.
Was bedeutet es, eine „Gelegenheitsquelle“ zu sein? Der Begriff bezeichnet eine Person, die dem Nachrichtendienst zwar keine regelmäßigen, aber wiederholt Informationen liefert – in der Regel ohne festes Vertragsverhältnis oder ständige Verpflichtung. Laut BND handelte es sich bei Scholl-Latour nicht um einen „regulären Informanten“, er habe auch kein Geld erhalten und keinen dauerhaften Auftrag gehabt. Trotzdem zeigt die Aktenlage: Seine Informationen wurden vom BND gezielt abgeschöpft und verwendet.
Scholl-Latours Kontakte zu BND-Mitarbeitern namens „Sallinger“ und „Tebs“, die für den Nahen und Mittleren Osten zuständig waren, waren offenbar nicht nur zufälliger Natur. So ist dokumentiert, dass Scholl-Latour den Geheimdienst bei der Identifikation von Personen unterstützte und sogar BND-Mitarbeitern Zugang zu exklusivem Material verschaffte. Besonders heikel: Der Journalist soll bereit gewesen sein, Filmmaterial noch vor TV-Ausstrahlung an den BND weiterzugeben. In den Unterlagen heißt es, Scholl-Latour habe ausdrücklich angeboten, einen BND-Mitarbeiter zur „Visionage“ ins ZDF-Studio zu bringen – „Wiesbaden scheide aus, da es dort zuviele ‚Neugierige‘ gäbe.“
Journalistische Unabhängigkeit unter Druck? Die Grenze zwischen Recherche und Instrumentalisierung
Die Enthüllungen werfen grundsätzliche Fragen zum Verhältnis von Journalismus und staatlichen Akteuren auf. Darf ein Journalist, der sich der Unabhängigkeit und Objektivität verpflichtet sieht, Informationen mit Nachrichtendiensten teilen – und das womöglich, ohne seine Redaktion oder das Publikum davon zu informieren? Medienethiker mahnen seit Jahren, dass solche Kontakte die Glaubwürdigkeit und Neutralität von Berichterstattung gefährden könnten.
Das ZDF, für das Scholl-Latour regelmäßig tätig war, bestreitet laut WDR jegliche Kenntnis über derartige Vorgänge. „Das ZDF hat keine Kenntnis über die geschilderten angeblichen Vorgänge aus den 80er Jahren“, so eine Sprecherin. Man orientiere sich an den publizistischen Leitlinien und am Pressekodex – ein Grundsatz, der auch bei Kontakten zu Behörden gelte. ZDF
Auch der BND bemüht sich um Schadensbegrenzung: Zwar hätten die Akten den Begriff „Nachrichtendienstliche Verbindung“ (NDV) verwendet, dies sei jedoch nur „fälschlicherweise“ geschehen. Eine „reguläre Anwerbung“ habe es nicht gegeben. Dennoch: Die Unterlagen zeigen, wie eng der Informationsaustausch zwischen Journalisten und Nachrichtendiensten manchmal verlaufen kann.
Juristisch betrachtet ist der Umgang mit Quellen und Informanten in Deutschland durch das Grundgesetz (GG) geschützt. Artikel 5 GG garantiert die Pressefreiheit, zugleich verpflichten zahlreiche Gesetze und Gerichtsurteile zur Wahrung von Redaktionsgeheimnissen.
Leitsatz: Ein Journalist darf Informationen an Behörden nur weitergeben, wenn keine schutzwürdigen Interessen der Informanten verletzt werden und die Pressefreiheit nicht unverhältnismäßig beeinträchtigt wird.
(BVerfG, Urteil vom 27.02.2007, Az. 1 BvR 538/06)
Im Fall Scholl-Latour bleibt offen, ob der Journalist seine Verpflichtungen gegenüber Auftraggebern und Informanten verletzt hat. Da weitere Akten mit Verweis auf den Schutz nachrichtendienstlicher Methoden unter Verschluss bleiben, bleibt vieles im Unklaren.
Für die Recherche dieses Artikels wurden auch weiterführende Informationen über die Rolle des BND in der Medienlandschaft, etwa durch die Wikipedia sowie das BND-Archiv, ausgewertet.
Wer auf die Debatte um Medien und Staat Einfluss nehmen möchte, findet beispielsweise bei der Organisation Reporter ohne Grenzen umfangreiche Hintergrundberichte und rechtliche Hinweise zur Pressefreiheit.
Was bleibt: Fragen an eine offene Gesellschaft
Der Fall Peter Scholl-Latour ist kein Einzelfall, sondern ein Beispiel dafür, wie eng staatliche Stellen und Medienakteure manchmal zusammenarbeiten. Auch heute stellt sich die Frage, wie viel Nähe zwischen Journalisten und staatlichen Organen noch vertretbar ist.
SN SONNTAGSNACHRICHTEN fordert eine offene gesellschaftliche Debatte:
Wie kann journalistische Unabhängigkeit auch künftig gesichert werden? Wie transparent müssen Kontakte zwischen Medien und Behörden gemacht werden? Was bedeutet der Fall für das Vertrauen in Medien insgesamt?
Für Leserinnen und Leser, die sich für investigative Berichterstattung und die gesellschaftliche Kontrolle von Nachrichtendiensten interessieren, empfiehlt die Redaktion einen Blick in die Rubrik Boulevard der SN SONNTAGSNACHRICHTEN.
Für Interessierte an Biografien und Hintergründen von Peter Scholl-Latour gibt es im Buchhandel zahlreiche Werke, beispielsweise seine Autobiografie u. a. bei Amazon.
Abschließend bleibt festzuhalten: Der Schutz von Pressefreiheit und die sorgfältige Trennung von Berichterstattung und nachrichtendienstlicher Einflussnahme bleiben ein Prüfstein für den Zustand unserer Demokratie.
SN SONNTAGSNACHRICHTEN wird die weitere Entwicklung kritisch begleiten.