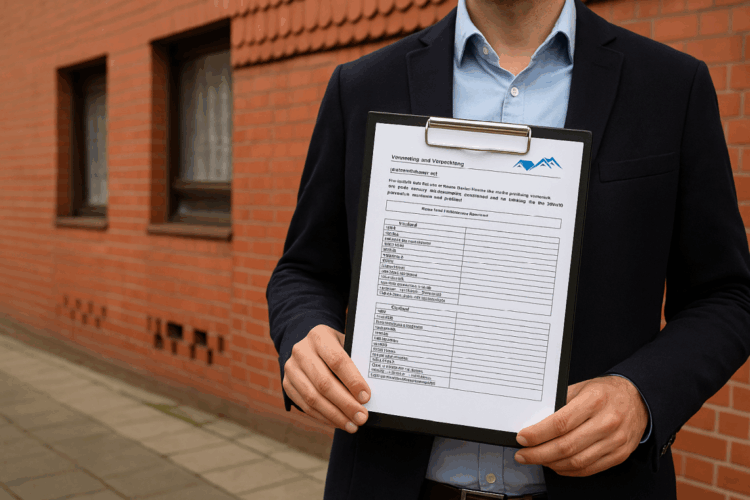Herne. [sn]
„Wir wollten nur eine Wohnung besichtigen. Stattdessen sollten wir noch vor dem ersten Termin Nettoeinkommen, Kredite und sogar Unterhaltsverpflichtungen preisgeben – für die Leibnizstraße 14, Herne.“
Mit dieser Nachricht begann vor wenigen Wochen eine Recherche der SN SONNTAGSNACHRICHTEN. Über das Hinweisgebersystem meldeten sich mehrere Wohnungsbewerber:innen, die auffällig frühe und umfangreiche (freiwillige) Datenerhebungen durch eine lokale Immobilienfirma schilderten. Parallel verdichteten sich Hinweise, dass eine leitende Kraft im Bereich Öffentliche Ordnung der Stadt Herne nebenamtlich in Immobilien- und Dienstleistungsfirmen aktiv sein könnte. Beides zusammen wirft eine Frage von grundsätzlicher Tragweite auf:
Wie unabhängig und wirksam kann ein kommunaler Ordnungsdienst arbeiten, wenn Führungskräfte zeitgleich privat in genau den Märkten agieren, die sie dienstlich beaufsichtigen sollen – und wenn bei der Datenerhebung gegenüber Wohnungssuchenden offenkundig rechtsstaatliche Leitplanken von eben diesen ausgereizt werden?
Wenn der erste Schritt schon zu weit geht: Datenerhebung vor der Besichtigung
Wer in angespannten Wohnungsmärkten sucht, kennt den Druck: Massenbesichtigungen, kurze Fristen, hohe Hürden. In einer solchen Lage sensible Informationen preiszugeben, erscheint vielen als „notwendiges Übel“. Rechtlich ist es das nicht. Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sieht in Artikel 5 den Grundsatz der Datenminimierung vor: Es dürfen nur diejenigen personenbezogenen Daten erhoben werden, die für den jeweiligen Zweck erforderlich sind. Für die bloße Vereinbarung und Organisation eines Besichtigungstermins sind Name, Kontaktweg und – je nach Konstellation – die Anzahl der einziehenden Personen ausreichend.
Auffällig ist zudem der Hinweis in der Mieterselbstauskunft, es handele sich um „freiwillige“ Angaben. Zusätzlich sollten die künftigen Mieter:innen die Freiwilligkeit auch noch bestätigen: „Ich/wir versichern ausdrücklich, dass die vorgenommenen Angaben freiwillig erteilt wurden.“ Genau diese letztere Klausel untermauert den Datenschutzverstoß, weil sie zeigt, dass dem Vermieter das Problem der Freiwilligkeit bewusst ist und er versucht, es durch eine formale Floskel zu umgehen. Juristisch ist dieser Versuch durchschaubar und unwirksam. Ein Gericht oder eine Datenschutzbehörde würde die tatsächlichen Umstände (Wohnungsnot, „Friss oder stirb“-Situation) bewerten und diese erzwungene „Freiwilligkeit“ nicht anerkennen. Praktisch stehen Bewerber:innen unter erheblichem Druck, sämtliche Felder auszufüllen, um nicht den Eindruck zu erwecken, sie würden ihre Chancen auf eine Wohnungsbesichtigung schmälern.
Ebenso findet sich im Formular der Hinweis: „Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich und im Einklang mit der DSGVO gespeichert, verarbeitet und gelöscht.“ Was auf den ersten Blick beruhigend klingt, erweist sich bei näherem Hinsehen als inhaltsleer. Denn es bleibt völlig undurchsichtig, wer konkret für die Datenverarbeitung verantwortlich ist, wie diese erfolgt und wann die sensiblen Angaben tatsächlich wieder gelöscht werden. Ohne klare Pflichtangaben zu Verantwortlicher Stelle, Speicherfristen und Betroffenenrechten bleibt dieser Hinweis eine bloße Floskel – rechtlich unzureichend und für Bewerber:innen praktisch wertlos.
Anonymisierte Testanfragen der SN SONNTAGSNACHRICHTEN nach einem Besichtigungstermin blieben ohne jede Reaktion. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass ohne Rückgabe des vollständig ausgefüllten Formulars überhaupt keine Besichtigungstermine vergeben wurden.
Die pauschale Abfrage von Netto-Einkommen, Arbeitgeber, Beschäftigungsdauer, Krediten, Leasingraten, Unterhaltslasten oder gar der Geburtsdaten von Kindern vor der ersten Besichtigung überschreitet diese Schwelle deutlich. Auch die oft bemühte „Vertragsanbahnung“ (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DS-GVO) trägt in dieser frühen Phase nicht. Vor Vertragsschluss unterscheiden die Datenschutzaufsichtsbehörden sinnvoll zwischen drei Stufen:
- Termin und Besichtigung (nur Kontaktdaten),
- konkretes Mietinteresse (erste Bonitätsangaben),
- und erst unmittelbar vor Abschluss (Nachweise: Gehaltsabrechnungen, Bonitätsauskunft, Identitätsprüfung).
Alles andere läuft auf eine unzulässige Datenübererhebung hinaus.
Diese Vorgehensweise hat sich längst wie ein geduldetes Übel in der Immobilienbranche eingeschlichen. Obwohl die Datenschutz-Grundverordnung klare Grenzen setzt, wird die systematische Übererhebung sensibler Daten von vielen Vermieter:innen und Makler:innen praktiziert – oft mit dem stillschweigenden Wissen, dass Wohnungssuchende in ihrer Not kaum widersprechen. Der Missstand ist bekannt, doch er wird selten sanktioniert. Statt transparenter Verfahren und rechtssicherer Stufenmodelle etabliert sich so ein Klima, in dem Übergriffigkeit zur Normalität und Rechtskonformität zur Ausnahme wird.
Wenn Transparenz fehlt: Wer steckt hinter dem Vermieter?
Besonders gravierend: Weder in der Immobilienanzeige, in den E-Mails des angeblichen „Vermieters“ noch in dem an die Wohnungsbewerber:innen versandten Formular „Mieterselbstauskunft aktuell.pdf“ fanden sich die nicht nur nach Art. 13 DS-GVO zwingend vorgeschriebenen Pflichtangaben. Für Bewerber:innen bedeutet das: Sie geben hochsensible Daten preis – Einkommen, Kredite, Familienstand – ohne zu wissen, wer der eigentliche Empfänger der Daten ist, wer konkret dafür verantwortlich ist, wie lange die Daten gespeichert werden oder welche Rechte sie geltend machen können.
Unsere naheliegende Frage lautete deshalb:
Warum versteckt sich der Vermieter?
Die Recherche führte uns zu TZ Immobilien – einer Firma, die nicht etwa von einem unbeteiligten Privatanbieter, sondern vom stellvertretenden Fachbereichsleiter „Öffentliche Ordnung“ der Stadt Herne geführt wird. Bei Sichtung der Registereinträge zeigt sich: Er fungiert mindestens in drei Firmen als Geschäftsführer und zusätzlich in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) als Gesellschafter. Unterm Strich ergeben sich vier aktive Nebentätigkeiten – parallel zu einem Leitungsamt, das eigentlich „vollen persönlichen Einsatz“ verlangt.
Verdient man im öffentlichen Dienst, insbesondere bei der Stadt Herne, so wenig, dass man gezwungen ist, solchen Nebentätigkeiten nachzugehen?
Dieses Spannungsfeld aus fehlender Transparenz gegenüber Wohnungssuchenden und gleichzeitiger Mehrfachfunktion im privatwirtschaftlichen Bereich verstärkt den Eindruck einer systematischen Entkopplung von Amtsverantwortung und unternehmerischen Interessen. Genau hier setzt unsere Berichterstattung an:
Wenn die Öffentlichkeit nicht einmal weiß, wer ihre Daten entgegennimmt – wie kann dann Vertrauen in die Integrität des Verwaltungshandelns bestehen?
Leitung in Doppelfunktion: Wenn Amt und Geschäft einander gefährlich nahekommen
Je höher das Amt, desto enger die Zügel. Das Landesbeamtengesetz NRW verpflichtet zur Versagung einer Nebentätigkeit, wenn dienstliche Interessen beeinträchtigt werden. Im Klartext: Wenn die Nebenbeschäftigung so viel Zeit frisst, dass die Hauptaufgabe leidet, wenn Interessenkonflikte drohen oder wenn der Anschein entsteht, dass Amtswissen in private Vorteile umgemünzt wird, darf es keine Genehmigung geben.
Noch gewichtiger ist der „strukturelle“ Konflikt: Wer im öffentlichen Dienst Regeln durchsetzen muss, sollte nicht gleichzeitig privat in Branchen aktiv sein, die von diesen Regeln betroffen sind. Das Verwaltungsverfahrensgesetz NRW regelt Befangenheit klar: Schon der berechtigte Eindruck, dass Amtsgeschäfte und private Interessen sich berühren, verpflichtet zur strengen Trennung. Geschieht das nicht, drohen Verfahrensfehler bis hin zur Rechtswidrigkeit.
Ein Jurist sagt dazu zu den SN SONNTAGSNACHRICHTEN: „Die Personalverwaltung hätte die Nebentätigkeiten rechtlich niemals genehmigen dürfen. Maßgeblich ist § 49 Landesbeamtengesetz NRW, wonach eine Genehmigung zwingend zu versagen ist, sobald dienstliche Interessen beeinträchtigt oder auch nur gefährdet erscheinen. Genau dies ist hier der Fall – gleich in mehrfacher Hinsicht:
Zeitliche Überlastung („Fünftel-Regel“): Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Urteil vom 28. Februar 2002 – 2 C 4.01) gilt die widerlegbare Vermutung, dass eine Nebentätigkeit, die mehr als ein Fünftel der regulären Wochenarbeitszeit beansprucht (ca. 8 Stunden), die dienstlichen Interessen beeinträchtigt. Die Geschäftsführung von drei GmbHs und die Beteiligung an einer GbR machen eine Einhaltung dieser Grenze lebensfremd.
Leitende Positionen im öffentlichen Dienst erfordern nach Art. 33 Abs. 5 GG und gefestigter Rechtsprechung (BVerwG, Urteil vom 26. März 2009 – 2 C 46.08) den vollen persönlichen Einsatz. Vier parallel geführte Unternehmen im Immobilien- und Gewerbesektor stehen in unauflösbarem Widerspruch zu diesem Grundsatz.
Nach § 49 Abs. 2 Nr. 2 LBG NRW muss eine Nebentätigkeit versagt werden, wenn sie dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung abträglich sein kann. Hier liegt ein permanenter Interessenkonflikt vor, da der Mitarbeiter privat genau in dem Sektor unternehmerisch tätig ist, für den er dienstlich Aufsichtspflichten wahrnimmt. Bereits der „böse Schein“ genügt, um das Vertrauen in die Neutralität der Verwaltung zu untergraben (vgl. OVG NRW, Beschluss vom 13. Dezember 2011 – 6 A 2261/10).
Die Personalverwaltung hätte zwingend zu dem Ergebnis kommen müssen, dass die Nebentätigkeiten nicht genehmigungsfähig sind. Eine erteilte Genehmigung wäre daher rechtswidrig und hätte vor den Verwaltungsgerichten keinen Bestand.“
Bauordnungs-/planungsrechtliche Komponente
Reine Wohngebiete sind nach § 3 BauNVO für Wohnzwecke vorgesehen. Firmenzwecke wie Gebäudemanagement, Handwerkerleistungen oder Anlieferungen wirken störend. Die Kumulation von drei der vier Unternehmen des Beamten an seinem Wohnsitz verstärkt die Gebietsfremdheit. Nach Auskunft der Stadt Herne ist eine baurechtliche Prüfung hierzu jedoch nicht erfolgt – ein Befund, der allein schon Fragen aufwirft. Warum ist dies seit Wochen nicht geschehen?
Ordnungsbehörde und Stadtverwaltung sind jetzt gefordert
- Formulare/E-Mails sind zwingend zu korrigieren: Pflichtangaben nach Art. 13 DS-GVO, DDG, HGB, GmbHG, GewO, GEG … gehören vollständig in jedes Dokument.
- Stufenmodell muss beachtet werden: Kontaktdaten zuerst, Bonitätsdaten später, Nachweise unmittelbar vor Vertragsabschluss.
- Nebentätigkeiten sind erneut zu prüfen: Für Leitungsposten minimal, transparent und fern vom eigenen dienstlichen Wirkungsfeld.
- Baurecht ist ernst nehmen: Reine Wohngebiete sind keine Sammelplätze für Geschäftstätigkeiten.
- Die interne Aufsicht ist zu stärken: Datenschutzaufsicht, Rechnungsprüfung und Personalstellen müssen ohne Rücksichtnahme auf Führungskräfte handeln können.
Praktische Hilfe für Wohnungssuchende
Wer vor der Vereinbarung eines Besichtigungstermins solche unsicheren Formulare vorgelegt bekommt, sollte nur Kontaktdaten angeben, vollständige Art-13-Informationen einfordern und sensible Nachweise erst im engsten Favoritenkreis liefern. Bei Zweifeln: die Landesdatenschutzbeauftragte einschalten, erreichbar über die Portale des Landes oder die Stadt Herne. Ein Verstoß gegen die Grundsätze der DSGVO (insbesondere Datenminimierung und Zweckbindung) stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die nach Art. 83 DS-GVO mit Bußgeldern von bis zu 20 Mio € oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes geahndet werden kann.
Fazit und Appell
Ein starker kommunaler Ordnungsdienst braucht starke Regeln – und Vorbilder, die sie vorleben. Wenn leitende Verwaltungsmitarbeitende privat vierfach unternehmerisch aktiv sind und dabei Transparenzpflichten gegenüber Wohnungssuchenden missachten, ist das mehr als ein Randthema. Es ist ein Risiko für Vertrauen, Integrität und Rechtsstaatlichkeit.
Deshalb unser Appell: Wer bei Bewerbungen um Wohnraum ähnliche Erfahrungen gemacht hat – insbesondere an der Leibnizstraße 14 in Herne –, wer ungewöhnliche oder ausufernde Datenabfragen vor dem ersten Besichtigungstermin erlebt hat, wem Zweifel an der richtigen Berechnung seiner Wohnfläche hat, möge sich vertraulich an die Redaktion der SN SONNTAGSNACHRICHTEN wenden. Nur mit belastbaren Stimmen der Betroffenen lässt sich das Bild vervollständigen – und verbessern.