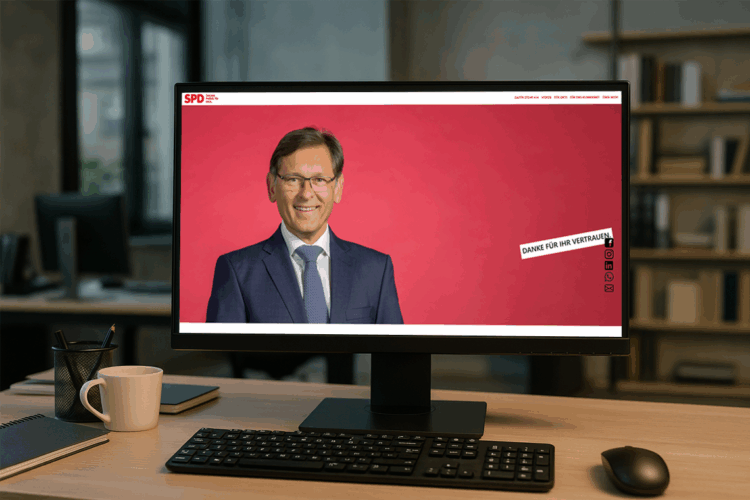Herne. [sn]
„Die AfD-Wählerschaft hat Dudda indirekt zum Sieg verholfen“
dieser Satz provoziert, hält aber der nüchternen Zahlenschau stand. Bei der Oberbürgermeisterwahl am 14. September 2025 erzielte Dr. Frank Dudda (SPD) 27.714 Stimmen (51,3 Prozent). Seine Partei lag bei der Ratswahl desselben Tages jedoch nur bei 20.378 Stimmen (37,0 Prozent). Der Abstand von 7.336 Stimmen ist erheblich – und er kommt nicht allein aus dem SPD-Lager. Unsere Auswertung der offiziellen Wahlergebnispräsentationen der Stadt Herne zeigt: Ein relevanter Teil stammt aus anderen Parteimilieus, darunter auch aus dem Umfeld der AfD. Auf Basis einer transparenten, proportionalen Differenzanalyse lässt sich die Größenordnung auf rund 1.500 Stimmen aus dem AfD-Spektrum schätzen, die in der OB-Wahl bei Dudda landeten. Ohne diese Stimmen hätte er die 50-Prozent-Hürde verfehlt – die Stichwahl wäre unausweichlich gewesen.
Stimmen aus der Stadtgesellschaft (ohne Anspruch auf Repräsentativität, aber symptomatisch):
- „Ich habe Dudda gewählt, nicht die SPD – aber von der AfD will ich nichts“, sagen Bürger:innen, die Sicherheit und Stabilität wollen.
- „Wir wollten den Wechsel – und haben ihn uns selbst verbaut“, heißt es aus Reihen, die den AfD-Kandidaten nominierten, deren Wähler:innen am Ende aber anders abstimmten.
- „Stimmen aus dem falschen Lager sind kein Geschenk, sondern eine Hypothek“, resümiert eine konservative Leser:innenstimme.
Die Rechnung, die den Tenor trägt
Zunächst die Grundlagen. Bei der OB-Wahl kamen die Kandidat:innen auf: SPD/Dudda 27.714 (51,3 Prozent), CDU/Szelag 8.288 (15,3 Prozent), GRÜNE/von der Beck 3.689 (6,8 Prozent), AfD/Zerbin 11.630 (21,5 Prozent), FDP/Bloch 671 (1,2 Prozent), Unabhängige Bürger/Blech 1.113 (2,1 Prozent), PIRATEN/Wind 923 (1,7 Prozent). Gültige Stimmen insgesamt: 54.028. Die Ratswahlzahlen am selben Tag: SPD 20.378 (37,0 Prozent), CDU 9.821 (17,8 Prozent), GRÜNE 4.655 (8,5 Prozent), AfD 12.353 (22,4 Prozent), Die Linke 3.105 (5,6 Prozent), FDP 982 (1,8 Prozent), Unabhängige Bürger 830 (1,5 Prozent), PIRATEN 651 (1,2 Prozent), BSW 1.195 (2,2 Prozent), HAK 1.078 (2,0 Prozent).

Die Methode: Wir vergleichen je Partei die Ratsstimmen mit den OB-Stimmen des:der zugehörigen Kandidat:in. Wo die OB-Stimmen niedriger sind als die Ratsstimmen, liegt ein „Abfluss“ vor. Duddas Mehrergebnis von 7.336 Stimmen lässt sich proportional zu diesen negativen Abweichungen verteilen. Ergebnis dieser Annäherung: ca. 3.200 Stimmen aus dem CDU-Umfeld, ca. 2.000 aus dem Umfeld der GRÜNEN, ca. 650 aus dem FDP-Umfeld – und rund 1.500 Stimmen aus dem AfD-Spektrum sind sehr plausibel.
Weshalb ist das entscheidend? Die 50-Prozent-Schwelle lag bei 27.014 Stimmen (50 Prozent von 54.028). Ohne die geschätzten AfD-Zustromstimmen hätte Dudda 26.214 Stimmen erreicht – das ist unter der Mehrheitsschwelle. Reine Mathematik, kein Spin.
„Die AfD-Wählerschaft verhalf Dudda indirekt zum Sieg“ ist deshalb kein zugespitztes Schlagwort, sondern die logische Lesart einer gespaltenen Wahlentscheidung. Diese Konstellation ist kommunal nicht ungewöhnlich: Bürger:innen trennen Person und Partei, wählen im Rat programmatisch, im Rathaus personell. Aber: Dass ausgerechnet Stimmen aus einem vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuften Milieu den Ausschlag geben, ist politisch brisant – und gehört klar benannt, nicht relativiert. Zur Erinnerung: Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat im Frühjahr 2025 bestätigt, dass die AfD und ihre Jugendorganisation „Junge Alternative“ als Verdachtsfall rechtsextremistischer Bestrebungen eingestuft bleiben dürfen. AfD wählen ist kein Protest.
Exorbitante Verluste, dünnes Mandat: Was jetzt politisch folgt
Die SPD hat in Herne deutlich verloren. Die Partei rutschte bei der Ratswahl auf 37,0 Prozent. Auch Duddas OB-Ergebnis zeigt einen Rückgang gegenüber früheren Wahlen. In der politischen Kultur unseres Landes gilt: Spitzenkandidat:innen haben sich schon für geringere Verluste persönlich verantwortlich gezeigt und „den Hut genommen“. Man muss keine lange Liste historischer Beispiele bemühen, um den Maßstab zu erkennen: Wer deutlich verliert, zieht Konsequenzen – sei es durch Rücktritt, Amtsaufgabe oder den Verzicht auf Parteifunktionen.
„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben!“ (russisch «Кто опаздывает, того наказывает жизнь.»)
Genau deshalb fällt das heurige Ergebnis so schwer ins Gewicht: Ein linker Oberbürgermeister, der seine Direktwahl nur erreicht, weil rund 1.500 Stimmen aus dem AfD-Spektrum die 50-Prozent-Marke kippen, steht auf einem politisch dünnen Mandat. Das ist kein moralischer Vorwurf an Bürger:innen, die im Einzelfall split-ticket wählen (gespaltene Wahlentscheidung). Es ist ein nüchterner Befund: Die Mehrheit resultiert aus Stimmenwanderungen, die aus demokratiepolitisch kritischem Umfeld kommen. Das darf nicht weichgezeichnet werden.
Die Linie muss deshalb klar gezogen werden: Die AfD-Stimmen sind kritisch zu betrachten und nicht zu relativieren. Ein:e demokratische:r Amtsinhaber:in, der:die sein: ihr Mandat ohne diese Stimmen nicht erreicht hätte, muss sich daran messen lassen, ob er:sie sich unmissverständlich abgrenzt – und ob künftige Mehrheiten wieder aus einem eindeutig demokratischen Spektrum kommen.
Was folgt daraus für Herne?
- Erstens: Ehrlichkeit über die Basis des Wahlsiegs. „Gewählt – ja. Aber das Vertrauen ist geliehen“. Ein Amtsbonus trägt nur, solange Leistung, Transparenz und klare Abgrenzung sichtbar bleiben.
- Zweitens: Solide Finanzen und Prioritäten. Bürger:innen erwarten weniger Symbol- und mehr Substanzpolitik: saubere Haushalte, verlässliche Infrastruktur (Schulen, Straßen, Bäder), geordnete Stadtentwicklung.
- Drittens: Politische Hygiene. Kein taktisches Lavieren, keine Relativierungen gegenüber extremistischen Rändern. Klare Kante, rechtsstaatlich begründet.
- Viertens: Konsequenz ist keine Schwäche. Andere Spitzenleute haben bei geringeren Verlusten Verantwortung übernommen. Wer jetzt – trotz „Direktwahl auf Kante“ und dank kritischer Stimmen – so weitermacht wie bisher, riskiert Vertrauensverluste jenseits des eigenen Lagers.
Die Lehren für die Opposition?
Die AfD hat, objektiv betrachtet, sich und ihrem Kandidaten einen Bärendienst erwiesen: Ein Teil ihrer Wähler:innen stimmte bei der OB-Wahl nicht für den eigenen Kandidaten, sondern stärkte den Amtsinhaber – und verhinderte damit sehr wahrscheinlich den Wechsel an der Rathausspitze nach zehn Jahren Duddaismus und fünfzig (50) Jahren SPD-Regierung. Das ist politikwissenschaftlich klassisches Fehlverhalten im Machtkalkül.
Kommentar der SN SONNTAGSNACHRICHTEN
Die Direktwahl steht auf dem Papier – politisch steht sie auf Zehenspitzen. Die AfD hat Dudda indirekt zum Sieg verholfen; ohne diese Wanderung wäre die Stichwahl gekommen. Wer die Stadt führen will, muss nun erst recht beweisen, dass seine Mehrheit künftig auf demokratisch unstrittiger Grundlage steht. Alles andere bleibt ein Risiko für die Integrität des Amtes – und für die politische Kultur in Herne.
Personalisierung, Amtsbonus, gespaltene Wahlentscheidung, taktisches Verhalten – all das sind etablierte Phänomene. Wer lokale Ergebnisse nur über Bundes- oder Landestrends liest, versteht Herne nicht. Kommunal entscheidet die Frage: Wer führt die Stadt verlässlich? Doch Verlässlichkeit ersetzt nicht die demokratische Hygiene. Ein linker Oberbürgermeister, der faktisch „durch Gnaden“ kritischer Stimmen bestätigt wird, sollte den Maßstab für sich höher legen – oder den Weg frei machen. Das wäre im Sinne einer politischen Kultur, die Verantwortung nicht nur rhetorisch großschreibt.