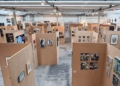Düsseldorf/Herne/Wanne-Eickel. [sn] Die Verwaltung der Stadt Herne und Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda feiern die Aufnahme der geplanten urbanen Seilbahn in den ÖPNV-Bedarfsplan des Landes Nordrhein-Westfalen als „Meilenstein“ und „innovative“ Lösung zur Anbindung des Areals General Blumenthal XI. Dort sollen zukünftig 4.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Doch während die Stadt die Förderfähigkeit der Investitionskosten (CAPEX) bejubelt, schweigt sie beharrlich über die eigentliche Gefahr: die dauerhaften Betriebskosten (OPEX). Herne, eine Kommune, die unter dem Diktat des Haushaltssicherungskonzepts (HSK) steht und seit Jahrzehnten überschuldet ist, droht, durch dieses Prestigeprojekt in eine finanzielle Zwangslage getrieben zu werden, die über Generationen hinweg spürbar sein wird. Dies völlig ohne Sinn und Verstand.
„Dat is Quatsch“,
so ein Wanne-Eickler im RTL Fernsehen – und er hat recht.
Bis vor Kurzem hielt der Autor die mit bemerkenswerter Sturheit betriebene Umbenennung des Hauptbahnhofs Wanne-Eickel durch Verwaltung und Lokalpolitik in „Herne-Wanne-Eickel“ für den einsamen Gipfel kommunalen Unsinns. Inzwischen drängt sich jedoch der Eindruck auf, dass die Idee einer Seilbahn quer über den Hauptbahnhof Wanne-Eickel diesen Negativrekord spielend übertreffen dürfte – als nächstes Kapitel in einer Verwaltungsgeschichte, in der Symbolpolitik und teure Prestigeprojekte offenbar deutlich mehr Gewicht haben als eine sachliche, am Bedarf der Bürger:innen orientierte Verkehrsplanung.
Die Stadtverwaltung präsentiert das Projekt als kostengünstiges Wunder:
„Die neue Seilbahn in Herne soll 32 Millionen € kosten und Teil des ÖPNV werden. Sie verbindet den Hauptbahnhof mit einem nahezu autofreien Gewerbegebiet und soll die Innenstadt beleben. Laut Frank Dudda ist die Seilbahn die kostengünstigste Lösung, um Tausende von Menschen zu transportieren. Im Vergleich dazu würde ein Umbau der U-Bahn 1 Milliarde € kosten. Herne von oben bietet zudem eine attraktive Aussicht“,
berichtete SAT.1 NRW.
Ein unabhängiges, wissenschaftliches Kurz-Gutachten, das im September 2025 erstellt und an alle Bewilligungsstellen sowie die zuständige Wirtschaftsministerin versandt wurde, legt eine vernichtende Analyse vor. Das Dokument stellt fest, dass die Seilbahn keineswegs die zweckmäßigste, wirtschaftlichste oder wetterresilienteste Lösung für Herne ist, sondern die mit dem höchsten finanziellen Risiko.
Der Mythos von der unbezahlbaren Alternative
Die Debatte um die verkehrliche Erschließung des Blumenthal-Areals wurde von der städtischen Seite lange durch die Überzeichnung der Alternativkosten dominiert. Man ließ in der öffentlichen Diskussion die falsche Zahl von 1 Milliarde € für eine mögliche U-Bahn-Lösung kursieren. Dieses Schreckgespenst dient offensichtlich nur der Rechtfertigung des Seilbahn-Projekts. Das Kurzgutachten widerlegt diese absurde Schätzung.
Realistisch betrachtet liegen die Investitionskosten für eine unterirdische Verlängerung der U-Bahn von einem Kilometer in Deutschland bei etwa 120 bis 300 Millionen € pro Kilometer. Eine Milliarde EUR ist somit um ein Vielfaches überzogen. Gerade im Ruhrgebiet sind derartige Kostenangaben für eine kurze U-Bahn-Ergänzung fachlich nicht haltbar. Diese Taktik diente offenbar nur dazu, die Seilbahn, deren Investitionskosten im Gutachten auf 25 bis 40 Millionen € geschätzt werden, als vermeintlich günstigste Option darzustellen.

Doch die wahre Kostenfalle liegt nicht in den einmaligen Bauausgaben, für die es Fördermittel gibt, sondern in den jährlichen Betriebskosten, die der städtische Kernhaushalt dauerhaft tragen muss. Die urbane Seilbahn Wanne-Eickel wird als sogenannter Stetigförderer betrieben, was bedeutet, dass eine hohe OPEX-Fixlast anfällt, die kaum von der tatsächlichen Nachfrage abhängt. Das Gutachten beziffert diese jährlichen Betriebskosten auf 2,0 bis 3,6 Millionen €.
Unbeantwortet bleibt die Frage, wie diese 4.000 neuen Arbeitsplätze und damit die Nutzer der Seilbahn von jetzt auf gleich entstehen sollen. Die städtischen Pläne sehen den Baubeginn erst gegen Ende des Jahrzehnts vor. Bis zur tatsächlichen Auslastung vergehen Jahre, während die jährliche OPEX-Fixlast von bis zu 3,6 Millionen € sofort anfällt. Wer soll den Betrieb dieses unsinnigen Systems später mit welchen Geldern bestreiten, da vonseiten der Stadt dazu kein Wort gesagt wird? Während eine Tram- oder U-Bahn-Verlängerung den Personalaufwand durch Integration in bestehende Strukturen minimiert, erfordert die Seilbahn zusätzliches Personal für Leitwarte, Stationen und Wartung. Es bleibt abzuwarten, wie die Förderstellen und Bewilligungsbehörden mit dem vernichtenden Inhalt des Kurzgutachtens umgehen.
Im Gegensatz dazu steht die Verlängerung der Tram- oder Stadtbahnlinie entlang der Dorstener Straße (B 226). Diese netzintegrierte Lösung wäre nicht nur deutlich länger (3,5 bis 4,5 km) und würde einen besseren Netzeffekt im gesamten Fördergelder ÖPNV-System entfalten, sie wäre auch im Betrieb günstiger. Der Ausbau der Straßenbahn (Tram Verlängerung B 226) in Richtung Crange, möglicherweise bis zu einem S-Bahn-Haltepunkt Herne-Crange, böte für den gleichen Investitionspreis (35 bis 70 Millionen €) einen Mehrwert für weitere Gewerbegebiete und die berühmte Cranger Kirmes, wäre wetterfest und dauerhaft nutzbar. Die jährlichen OPEX für die Tram liegen konservativ geschätzt bei nur 1,2 bis 2,0 Millionen €, da sie von Synergien im gesamten Tagesschau-Verbundraum profitiert. Für die Stadt Herne bedeutet die Seilbahn die Wahl der teuersten dauerhaften Defizitoption – ein verantwortungsloser Umgang mit Steuergeldern.
Absturzgefahr: Wenn Wind und Fixkosten das Projekt lähmen
Die Glaubwürdigkeit des Seilbahn-Projekts hängt davon ab, dass sie die 4.000 Arbeitsplätze zuverlässig anbindet. Doch gerade die Betriebssicherheit bei schlechtem Wetter ist die Achillesferse des Konzepts, was das Projekt von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die Seilbahn ist extrem wetteranfällig.
Ein Blick auf die Kölner Seilbahn Ausfall-Statistik und internationale Referenzen zeigt, wie oft der Betrieb eingestellt werden muss. Die Kölner Seilbahn, die als Referenz dienen könnte, stellt den Betrieb bereits ab einer Windgeschwindigkeit von 12 Metern pro Sekunde (etwa 43 km/h) ein. Bei stärkeren Böen oder Vereisung droht der Stillstand.
Die Erfahrung aus Köln ist dramatisch: 2017 musste die Feuerwehr 65 Passagiere, darunter 20 Kinder, aus einer Höhe von 40 Metern retten, nachdem eine Windböe eine Gondel aus der Führung gedrückt hatte. Dies ist kein Einzelfall: Die London Cable Car verzeichnete in nur 2,5 Jahren 354 Betriebsstörungen, wovon 249 direkt auf zu starken Wind zurückzuführen waren. Jedenfalls haben die Höhenretter der Grubenwehr und der städtischen Berufsfeuerwehr durch die Seilbahn einen sicheren Job.
Diese Unzuverlässigkeit führt direkt zu einem enormen Betriebsrisiko in Herne: Bei Wind oder Eis kann die Seilbahn die Pendler im Stich lassen. Die Folge ist die zwingende Notwendigkeit eines teuren Schienenersatzverkehrs (SEV), der die Hauptverkehrsstraßen zusätzlich belastet und den Verkehrskollaps verursacht, den die Stadt eigentlich verhindern will. Die Mitarbeiter, die bei Sturm nicht nach Hause kommen, werden schnell wieder auf das Privatfahrzeug umsteigen.
Hinzu kommt die zeitliche Dimension: Bis tatsächlich 4.000 Menschen im Gewerbegebiet General Blumenthal XI arbeiten, werden Jahre vergehen. Die Seilbahn generiert jedoch von Tag eins an ihre hohen OPEX-Fixkosten von bis zu 3,6 Millionen € jährlich, lange bevor sie ausgelastet ist. Das Geld wird somit für ein System verbrannt, das jahrelang brach liegt, was dem finanziellen Überleben von Herne, das unter der chronischen Überschuldung leidet, massiv schadet.
Das vernichtende Urteil und die Notwendigkeit des Bürgerentscheids
Das unabhängige Kurzgutachten zieht eine harte Bilanz und stellt der Politik in Herne ein verheerendes Zeugnis aus. So fordern inzwischen die Bürger und Experten die zuständigen Behörden auf, das Projekt sofort zu stoppen.
Im Kern zitiert das Gutachten, dass die Seilbahn nicht nur wetteranfällig ist und einen geringen Netzeffekt aufweist, sondern auch die kommunalaufsichtliche Finanzdisziplin (HSK) untergräbt. Die Experten kommen zu dem eindeutigen Schluss, der an die Bewilligungsstellen übermittelt wurde:
„Unter Berücksichtigung von Rechtsrahmen, Förderlogik, Haushaltslage (HSK) und Betrieb ist der Neubau der Seilbahn zwischen Hbf Wanne-Eickel und General Blumenthal XI nicht die zweckmäßigste Lösung.“.
Die klaren Gewinner des Variantenvergleichs sind die Tram Verlängerung B 226 und der Bau eines S-Bahn-Haltepunkts (S-Bf Herne-Crange), der mit nur 5 bis 12 Millionen € Investitionskosten extrem effizient wäre und sich in bestehende Systeme integriert. Diese Alternativen sind wetterrobuster und profitieren von einer besseren Kostendegression.
Angesichts dieser klaren Faktenlage, der demonstrativen Weigerung des Stadtrats Herne, wirtschaftlich sinnvolle Alternativen zu priorisieren, und der chronischen Überschuldung der Stadt, ist der Ruf nach einem Bürgerentscheid Herne unumgänglich. Kommunen wie Wuppertal zeigen, dass nur die direkte Demokratie ein politisch getriebenes Großprojekt stoppen kann, das die Bürger dauerhaft mit Betriebskosten belastet.
Es ist eine Frage der Verantwortung: Soll die Stadt Fördermittel in ein teures, anfälliges Inselsystem investieren und damit langfristige Haushaltslöcher reißen, oder soll sie die Gelder in robuste, netzintegrierte Lösungen stecken? Die Bürger müssen entscheiden, ob sie eine jährliche Fixlast von bis zu 3,6 Millionen € für eine wetteranfällige Seilbahn tragen wollen, oder ob das Geld, das sonst in kostspieligen Defiziten verbrennt, besser für die notwendige Sanierung anderer städtischer Infrastruktur ausgegeben wird.
Die Verantwortung liegt nun bei den Bürgern, zu verhindern, dass die Seilbahn zu einem Symbol der Fördermittelverbrennung wird.
Hier muss dringend eine kritische Debatte geführt werden, um die Steuergelder zu retten. Die Tram-Verlängerung B 226 und der S-Bahn-Haltepunkt Herne-Crange sind die zukunftssicheren Lösungen.