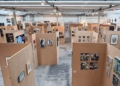Herne. [sn] Der Robert-Brauner-Platz ist inzwischen nahezu umgestaltet. Wer die Innenstadt passiert, sieht es sofort: ein neues Pflaster in Grau- und Weißtönen, streng rhythmisch verlegt. Was modern wirken soll, erinnert viele an ein Gestaltungsexperiment der 1970er Jahre – und erntet harsche Kritik. Bürger:innen fragen, ob man sich von der Stadtverwaltung verschaukelt fühlen muss, wenn Steuergelder in ein Pflaster fließen, das für manche Passant:innen eher ein Risiko darstellt als eine Aufwertung.
Gestaltung ist Realität – aber zu welchem Preis?
Die anfängliche Planungsphase versprach einen grüneren, einladenderen Platz. Online-Beteiligungen brachten Ideen für Bäume, Schattenplätze und Aufenthaltsqualität. Umgesetzt wurde jedoch vor allem das Pflaster. Nun liegt es großflächig da: rechteckige Steine in hellgrau, dunkelgrau und weiß, regelmäßig in Bändern angeordnet.
„Das soll eine Aufwertung sein? Das wirkt wie ein Flickenteppich aus den 70ern“,
klagt ein älterer Passant. Der Vergleich ist nicht weit hergeholt: Farb- und Formwahl erinnern stark an die Musteröffnungen jener Jahrzehnte, die heute eher als Stilbruch denn als zeitgemäß gelten.
Gesundheitsrisiken: Von Migräne bis Stolperfallen
Fachleute warnen, dass die kontrastreiche Pflasterung für bestimmte Personengruppen problematisch ist:
- Neurologisch empfindliche Menschen (z. B. mit Migräne oder photosensitiver Epilepsie) können durch die visuelle Abfolge der hell-dunklen Bänder Schwindel, Kopfschmerzen oder in Extremfällen Anfälle erleiden.
- Senior:innen und mobilitätseingeschränkte Bürger:innen haben Schwierigkeiten, sich auf den unruhigen Untergrund einzustellen. Schon leichte Unebenheiten oder unklare Kontraste erhöhen die Sturzgefahr.
- Sehbehinderte Menschen finden in der Musterflut kaum Orientierung. Für sie fehlen klare Leitstreifen, taktile Elemente oder ruhige Flächen.
Die in Nordrhein-Westfalen rechtlich-verbindlich geltende Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) verweist auf die DIN 18040-3, die die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum festlegt. Diese Norm schreibt nicht nur bauliche Anforderungen vor, sondern umfasst ausdrücklich auch Aspekte wie Kontrastreduzierung und visuelle Beruhigung. Ergänzend verweisen auch das „Merkblatt zum Rutschwiderstand von Pflasterbelägen“ (FGSV 407) sowie die „Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen“ (HBVA) auf die Notwendigkeit einer ruhigen, optisch klar gegliederten Gestaltung. Ziel ist es, allen Nutzer:innen – insbesondere Menschen mit Seh- oder Wahrnehmungsbeeinträchtigungen – eine sichere Orientierung und gefahrlose Nutzung zu ermöglichen. Diese Vorgaben hätten bei der Planung zwingend berücksichtigt werden müssen, wurden jedoch offenbar nicht umgesetzt.
Verfehlte Prioritäten bei der Umgestaltung?
Die Bürger:innenbeteiligung hatte klar signalisiert: weniger Stein, mehr Grün. Doch das Ergebnis zeigt das Gegenteil: ein steinernes Muster, das die Hitze im Sommer noch verstärkt. Bäume und Schatten sind bisher kaum sichtbar, stattdessen dominieren graue Flächen.
„Wir haben uns für mehr Aufenthaltsqualität eingesetzt, nicht für Schwindelattacken beim Einkaufen“,
sagt eine Ladenbesitzerin entnervt.
Dass die Stadtverwaltung trotz Kritik auf diese Lösung setzte, lässt viele zweifeln, ob öffentliche Gelder sinnvoll eingesetzt wurden. Die Kosten für das Pflaster belaufen sich laut internen Unterlagen auf mehrere hunderttausend Euro – Geld, das nach Meinung vieler besser in Grünflächen oder barrierefreie Wege geflossen wäre.
Ein Platz, der ausschließt statt einlädt?
Städtebauliche Wettbewerbe sollen eigentlich Lösungen schaffen, die den Bedürfnissen aller Bürger:innen gerecht werden. Im Fall des Robert-Brauner-Platzes wirkt es, als habe die Verwaltung vor allem auf ein „ästhetisches Statement“ gesetzt – und dabei Menschen mit besonderen Bedürfnissen übergangen.
Die optische Wirkung mag für einige „modern“ erscheinen. Doch wer genauer hinsieht, erkennt: Das Pflaster ist unruhig, blendet bei Sonnenschein und wirkt wie ein Musterlabor. Besonders problematisch ist, dass die Fläche in Bewegung – beim Gehen oder Fahren mit dem Rollator – temporale Reize erzeugt, die für sensible Menschen gesundheitlich riskant sein können.
Statt Inklusion zu fördern, wird so das Gegenteil erreicht: Exklusion durch Gestaltung.
Mehr Schein als Sein
Der Robert-Brauner-Platz hätte ein Symbol für eine moderne, grüne, inklusive Innenstadt werden können. Stattdessen prägt ihn nun ein Pflaster, das kritisiert wird als Rückfall in überholte Stilwelten der 1970er Jahre und als potenzielles Gesundheitsrisiko.
Die Stadt Herne muss sich den Vorwurf gefallen lassen, Steuergelder in eine Gestaltung investiert zu haben, die an den Bedürfnissen der Bürger:innen vorbeigeht. Der Platz wirkt wie ein teurer Irrtum – und lässt viele mit der Frage zurück: Wer genau profitiert von dieser Pflasteridee?