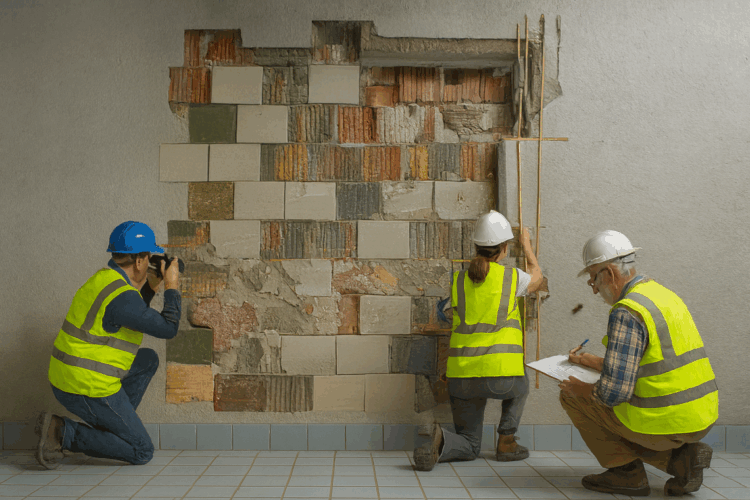Herne. [sn] Das Hallenbad Eickel in Wanne-Süd steht leer. Der geplante Abriss ist beschlossene Sache – glaubt man zumindest den Verlautbarungen der Stadt Herne. Doch ein genauerer Blick auf die Rechtslage zeigt: So einfach ist das nicht. Der Grund liegt in einer rechtlichen Hürde, die offenbar lange übersehen oder ignoriert wurde – das Urheberrecht an den großflächigen Wandmosaiken des Künstlers Edmund Schuitz.
Urheberrechtlich geschützt bis 31. Dezember 2062
Edmund Schuitz, 1992 verstorben, war der Schöpfer der eindrucksvollen Mosaiken im ehemaligen Hallenbad. Sie zeigen mythologische Szenen, darunter Amphitrite, Poseidon und andere Figuren aus der griechischen Sagenwelt. Wie das deutsche Urheberrecht in § 64 UrhG klar festlegt, endet der Schuitz erst 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers – also am 31. Dezember 2062.
Diese Frist ist bindend. Die Stadt Herne, obwohl Eigentümerin des Gebäudes, darf ohne Zustimmung der Rechtsnachfolgerin, der Tochter von Edmund Schuitz, die Mosaiken nicht entfernen oder zerstören. Denn das Gesetz schützt nicht nur das Werk selbst, sondern auch die persönliche Beziehung des Urhebers zu seinem Werk.
Die Zerstörung eines physischen (Kunst)Werkes, wenn die Handlung vorsätzlich vorgenommen wurde kann dies als Sachbeschädigung gemäß §§ 303, 303c StGB geahndet werden.
Gerichte geben Urhebern regelmäßig recht
Mehrere höchstrichterliche Urteile stützen die Position der Erben. Besonders hervorzuheben ist das Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs im Fall des Bonner Opernhauses (BGH, Urteil vom 05.10.1995 – I ZR 191/93). Dort wurde entschieden:
Leitsatz: Ein Eigentümer darf ein urheberrechtlich geschütztes Werk nicht ohne weiteres entfernen oder zerstören, wenn dadurch die berechtigten Interessen des Urhebers oder seiner Erben verletzt werden (§ 14 UrhG).
Die Rechtsprechung verlangt eine konkrete Interessenabwägung: Hat das Werk künstlerischen Rang? Ist es fest mit dem Gebäude verbunden? Wäre eine Erhaltung oder Versetzung zumutbar? Nur wenn der Eigentümer gewichtige, überragende Interessen nachweisen kann – etwa eine Gesundheitsgefahr oder zwingende öffentliche Planungsvorgaben – kann der Schutz im Einzelfall zurücktreten.
Auch im Fall des Palasts der Republik (BGH, Urteil vom 12.03.2004 – V ZR 243/02) wurde die Interessenabwägung betont. Damals sprach der Bundestagsbeschluss für einen symbolischen Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses ein „überragendes öffentliches Interesse“ aus. Solche Argumente liegen im Fall Hallenbad Eickel bislang nicht vor.
Kein öffentliches Interesse – kein Abrissrecht
Nach den bisherigen Planungen gibt es kein zwingendes öffentliches Interesse, das den Abriss rechtfertigen würde. Weder ist das Gebäude akut einsturzgefährdet, noch liegen Baugenehmigungen für eine Folgeplanung vor. Die Pläne der Stadt basieren vor allem auf städtebaulichen Vorstellungen – doch das reicht nicht.
Ein öffentliches Interesse im Sinne der Rechtsprechung liegt nur dann vor, wenn:
- der Bestand des Gebäudes eine akute Gefahr darstellt (z. B. durch Schadstoffe),
- ein Alternativstandort für wichtige öffentliche Einrichtungen fehlt oder
- demokratisch legitimierte Beschlüsse auf höherer Ebene (z. B. Landesparlament) eine konkrete Nutzung verlangen.
All das trifft auf das Hallenbad Eickel nicht zu. Selbst die Entfernung der Mosaiken würde laut eines Gutachtens der Bürgerinitiative nur rund 95.000 € kosten – ein Betrag, der angesichts geplanter Millionenprojekte in Herne als zumutbar gilt. Fachliteratur zum Urheberrecht betont regelmäßig, dass wirtschaftliche Argumente allein nicht ausreichen, um das Urheberpersönlichkeitsrecht zu überwinden.
Stellungnahmen und Widerstand mehren sich
Die Tochter des Künstlers, Ingeborg Müller-Schuitz, befindet sich seit Jahren in einer „Auseinandersetzung“ mit dem Thema, wie Sie den SN SONNTAGSNACHRICHTEN schreibt. Sie verweist auf die Stellungnahme des Historischen Vereins Wanne-Eickel sowie auf eine Expertise des renommierten Denkmalpflegers Dr. Hanke. Darin wird dargelegt, dass Schuitz kein überzeugter Nationalsozialist war und seine Kunst weder propagandistisch noch ideologisch belastet sei – anders als dies vereinzelt von städtischen Stellen behauptet wurde.
Bislang verweigert die Stadt jede ernsthafte inhaltliche Diskussion. Auch das Rederecht in Ausschüssen wurde mehrfach abgelehnt. Eine Anfrage an den Petitionsausschuss blieb unbeantwortet. Der Verdacht: Man will das Thema aussitzen – oder es in rechtlicher Grauzone versenken.
Die Stadt Herne sitzt in der Falle
Fakt ist: Solange das Urheberrecht besteht, kann ein Abriss oder eine Zerstörung der Mosaiken nur mit Zustimmung der Erbin erfolgen – oder gegen sie durchgesetzt werden. Letzteres wäre juristisch riskant, politisch heikel und finanziell gefährlich.
Denn sollte ein Gericht entscheiden, dass die Mosaiken rechtswidrig entfernt oder zerstört wurden, drohen Schadensersatzansprüche, einstweilige Verfügungen und Imageschäden. Für die Stadt, aber auch für die politisch Verantwortlichen.
Was bleibt?
Bringt man es auf den Punkt: „Ein geplanter Abriss vor 2062 ist entweder dilettantisch oder mutwillig rechtswidrig.“
Der Abriss des Hallenbads mag politisch gewollt sein. Aber er ist rechtlich auf Jahre hinaus blockiert. Wer dennoch mit Baggern anrücken will, riskiert mehr als einen Baustopp – nämlich einen kulturpolitischen Skandal.