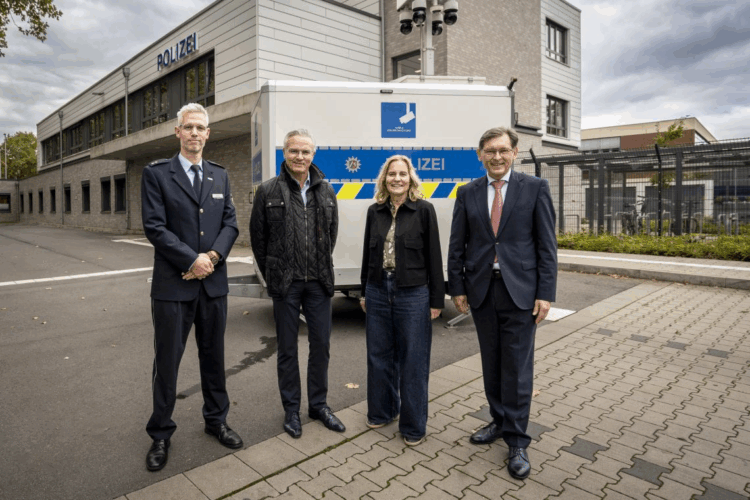Herne. [sn] Seit dem 13. Oktober 2025 überwacht eine mobile Videoanlage der Polizei den Buschmannshof. Stadt und Polizei verkaufen die Maßnahme als Signal für mehr Sicherheit in einem Bereich, der seit Jahren als Kriminalitätsschwerpunkt gilt. Doch wer die einschlägige Rechtsprechung kennt, erkennt sofort: Die rechtliche Basis dieser Installation ist mehr als fragil.
Das Kölner Urteil als Maßstab
Das Verwaltungsgericht Köln (VG Köln) hat mit Urteilen u. a. vom 28. November 2024 (Az. 20 K 4855/18, openJur, 20 L 2340/19, 20 L 2344/20, 20 L 2343/20, u. a.) die Voraussetzungen für Videoüberwachung im öffentlichen Raum nach § 15a Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen (PolG NRW) drastisch verschärft. Kernaussage: Ein „Kriminalitätsschwerpunkt“ liegt nur dann vor, wenn die Belastung mit Straßenkriminalität pro Hektar mindestens zehnmal so hoch ist wie im städtischen Durchschnitt (Rn. 144 ff.). Das ist nach den Informationen, die den SN SONNTAGSNACHRICHTEN vorliegen, offensichtlich nicht der Fall.
Diese Schwelle ist extrem. Sie zwingt die Polizei, statistische Daten vorzulegen, die einen außergewöhnlich hohen Kriminalitätsdruck belegen. Subjektive Einschätzungen („Angstraum“) oder das bloße Auflisten einiger Delikte reichen nicht aus. Genau hier liegt das Problem in Herne: Die Pressemitteilung von Polizei und Stadt nennt zwar Taschendiebstähle, Körperverletzungen und Drogendelikte, bleibt aber jegliche quantitativen Belege schuldig.
Ohne diesen Nachweis wäre eine Klage praktisch sicher erfolgreich.
Geografische Präzision und Sonderflächen
Das VG Köln hat außerdem festgelegt, dass Überwachung nur exakt die nachgewiesenen Hotspot-Flächen erfassen darf. Randbereiche sind tabu. In Herne handelt es sich um einen Anhänger mit sechs Kameras, die flexibel auf bis zu fünf Meter Höhe ausgefahren werden. Positiv ist die technische Anpassungsfähigkeit. Doch unklar bleibt, wie die Polizei sicherstellt, dass nicht angrenzende Bereiche oder private Wohnungsfenster mit gefilmt werden.
Außengastronomie darf während der Öffnungszeiten nicht überwacht werden, da sie nicht als „öffentlich zugänglich“ gilt (Rn. 161 ff.). Die Außengastronomie am Buschmannshof der Xtra Wurst Lounge und vom Seyran Grill, muss strikt ausgenommen werden. Ansonsten ist die Überwachung schon aus diesem Grund rechtswidrig.
Verhältnismäßigkeit und Grundrechte
Das Kölner Gericht akzeptierte in engen Grenzen eine permanente 24/7-Überwachung mit 14-tägiger Speicherung.
Herne hat formal einen milderen Weg gewählt: Die Kameras laufen nur zu „tatrelevanten Zeiten“, die Maßnahme ist zunächst auf einige Wochen befristet, und die Wirkung soll überprüft werden. Das spricht für die Verhältnismäßigkeit. Doch selbst dieser Pluspunkt ändert nichts an der Kernfrage: Ohne Nachweis der „zehnfachen Kriminalitätsdichte“ fehlt die Grundlage.
Besonders sensibel ist zudem der Schutz der Versammlungsfreiheit nach Art. 8 GG. Das VG Köln verlangte, dass Kameras spätestens eine Stunde vor Beginn und bis 30 Minuten nach Ende einer Versammlung vollständig abgeschaltet werden (Rn. 177 ff.). Andernfalls entstehe ein „Chilling Effect“ – Teilnehmende würden durch Überwachung abgeschreckt. Die Mitteilung der Stadt Herne schweigt hierzu. Tatsache ist, dass regelmäßig nicht nur politische Veranstaltungen am Buschmannshof stattfinden.
Bestätigung durch das OVG Münster
Die Linie des VG Köln ist mittlerweile durch das Oberverwaltungsgericht Münster (OVG Münster) bestätigt worden. In mehreren Entscheidungen u. a. vom 14. Juni 2024 (Az. 5 B 137/21, 5 B 264/21, 5 B 1289/21, 5 A 1211/23, juris, u. a.) stellte das OVG klar, dass Videoüberwachung im öffentlichen Raum nur unter engsten Voraussetzungen zulässig ist. Insbesondere betonte das Gericht erneut die Notwendigkeit empirisch belastbarer Daten und die Pflicht zur Abschaltung bei Versammlungen.
Damit ist klar: Auch wenn die Polizei Herne die Maßnahme als temporär und flexibel darstellt – die rechtlichen Hürden sind hoch, und die Chancen, diese vor Gericht zu nehmen, beträchtlich.
Verwaltungsversagen statt Sicherheit
Die Videoüberwachung am Buschmannshof wirkt wie ein politisches Symbol. Sie signalisiert Handlungsfähigkeit, verschleiert aber die juristische Unsicherheit. Die Maßnahme ist so lange in Kraft, bis jemand klagt. Und sollte ein Gericht entscheiden, wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit herausstellen: Die Überwachung ist unzulässig, weil die Polizei keine ausreichende Datengrundlage vorlegen kann.
Das eigentliche Problem liegt nicht bei den Kameras, sondern bei der Verwaltung: Hätte sie ihre Hausaufgaben gemacht und die Anforderungen aus Köln und Münster beachtet, stünde die Maßnahme auf tragfähigerem Boden. So aber bleibt sie ein Beispiel dafür, wie Aktionismus rechtliche Sorgfalt ersetzt – mit absehbaren Konsequenzen.
Man streut den Bürger:innen Sand in die Augen und suggeriert Aktionismus für eine vermeintliche Sicherheit – ohne dabei sinnvollerweise den Personalaufwand bei den Sicherheits- und/oder Ordnungskräften erhöhen zu müssen.